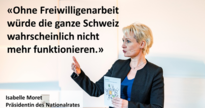Im Gespräch mit Tibère Adler, Direktor des think tanks Avenir Suisse für die Romandie.
Herr Adler, Sie haben im Auftrag von Avenir Suisse ein Buch veröffentlicht, das Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Milizengagement in der Schweiz fordert. Warum interessiert sich ein Wirtschaftsverband für dieses Thema?
Das Milizsystem, wie wir es in der Schweiz kennen, besteht im bürgerschaftlichen Engagement in der Gesellschaft, sei es in der Armee, in der Politik, in den Kirchen oder im Vereinsleben. Diese Beteiligung ist in unserem Land sehr ausgeprägt. Es handelt sich um eine Säule unserer nationalen Identität, vergleichbar mit der direkten Demokratie oder mit dem Föderalismus. Dieser Geist der Mitverantwortung für das Ganze verschafft unserem Land eine Art Wettbewerbsvorteil im Vergleich mit anderen. Er stärkt die Identität und eine Form bürgerschaftlicher Gesellschaftsverantwortung, die es zu ermutigen und zu bewahren gilt. Das ist der Grund, weshalb Avenir Suisse sich für das Thema interessiert; denn Avenir Suisse versteht sich als think tank für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten. Unsere Stiftung beschränkt sich nicht auf den Bereich der Wirtschaft.
Avenir Suisse stellt als eine mögliche Massnahme zur Stärkung des Milizsystems die Einführung eines „Bürgerdienstes“ zur Diskussion. Was ist damit gemeint? Könnte man diesen Bürgerdienst auch in Form von Milizengagement in einer der anerkannten Kirchen leisten?
Der Bürgerdienst wäre eine neue Form des Dienstes, geprägt von der Absicht, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, der für eine Schweiz in guter Verfassung zentral ist. Das Konzept sieht vor, dass alle Mitbewohner – Frauen, Männer, Einheimische oder in der Schweiz wohnhafte Ausländer – einen Teil ihrer Zeit (z.B. 200 Tage in einem bestimmten Zeitraum) für Tätigkeiten einsetzen müssten, die der Gemeinschaft zu Gute kommen. Dieser Bürgerdienst könnte wie bisher in der Armee oder im Zivildienst geleistet werden. Aber es könnten künftig auch andere Aktivitäten wie jene in einer (anerkannten) Kirche oder in einer Gemeindebehörde anerkannt werden.
Anlässlich einer Tagung der RKZ zum Thema haben Sie nicht nur ein Referat gehalten, sondern auch beobachten können, wie Kirchenleute mit das Thema Milizengagement diskutieren. Haben Sie im Vergleich mit der Diskussion in anderen Kreisen, z.B. in der Politik oder in der Wirtschaft, andere Akzente oder Fragestellungen festgestellt?
Was mich erstaunt hat, ist dass die Probleme der rückläufigen Beteiligung im Milizengagement sich für die Kirchen genau gleich stellen wie in den anderen Bereichen, in der Politik oder in den Vereinen. Die Schwierigkeiten sind dieselben: Zeitmangel, Auseinanderfallen von Wohn- und Arbeitsort, Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Der strukturierte, institutionelle und formelle Charakter des Milizengagements stossen zunehmend auf Ablehnung, vornehmlich bei den Jungen. Warum auch soll man sich in einem Vereinsvorstand mit endlosen Sitzungen vor Ort engagieren, während es so einfach ist, eine Facebook-Gruppe ins Leben zu rufen?
Haben Sie Erwartungen an die Kirchen im Zusammenhang mit dem Thema Milizengagement? Was könnte aus Ihrer Sicht deren spezifischer Beitrag zur Stärkung des Milizsystems in der Schweiz sein?
Über ihren Grundauftrag hinaus können die Kirchen das Milizsystem in der Schweiz am Leben und in Bewegung halten. Wenn sie sich nur auf streng religiöse Aktivitäten im innersten Kreis ihrer Mitglieder beschränken, sind sie für Menschen, die sich neu beteiligen möchten, wenig attraktiv. Aber wenn sie sich für das Gemeinwohl einsetzen, profitieren sie von grosser Glaubwürdigkeit und von einem Vertrauen in die Ernsthaftigkeit ihres Engagements, womit sie viel bewegen können. Das ist kein Widerspruch. Je praktischer und konkreter das Milizengagement, desto zahlreicher jene, die sich beteiligen – und umso mehr blüht das Engagement und entfaltet Wirkung.
Wenn Sie den Verantwortlichen drei konkrete Massnahmen zur Förderung des Milizengagements in den Kirchen vorschlagen müssten: Was würden Sie anregen?
Ich würde drei Dinge empfehlen:
- Projektartiges Vorgehen. Milizengagement, das ein institutionelles Engagement erfordert, ist nicht sehr attraktiv und stellt besondere Anforderungen. Projekte sind zugänglicher. Die Kirchen müssen lernen, zahlreiche Projekte zu entwickeln, sich immer wieder zu erneuern, statt Strukturen zu erhalten, die unveränderbar erscheinen.
- Formalismus und Bürokratie vermeiden. Selbst gut gemeinte Bürokratie schreckt ab und entmutigt jene, die sich engagieren möchten.
- Den Beitrag zum Gemeinwohl in den Vordergrund stellen und jeden Eindruck vermeiden, man wolle Menschen beteiligen, um sie zu «missionieren». Glaube ist etwas sehr persönliches. Die Kirchen können mehr bewirken, wenn sie nicht ausschliesslich die praktizierenden Gläubigen in den Blick nehmen.
Ähnliche Nachrichten